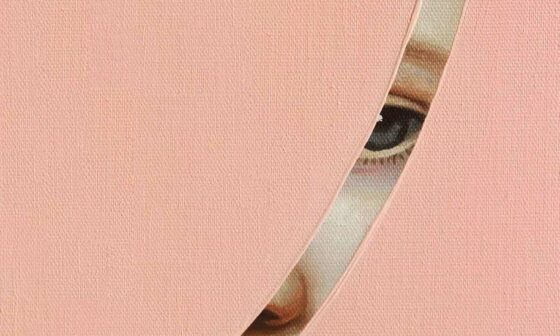Auf einen Klick: Moralstücke im Wandel // Novum in Europa // Der Superplex // „Holy shit!“ // Den Teufelskreis durchbrechen // Motive und Konflikte // Wrestling als Medium
Es mag nicht sehr originell sein, einen Text über Frauen-Wrestling mit einer Szene aus der gefeierten Netflix-Serie GLOW zu beginnen, ich tue es dennoch.
Mitte der ersten Staffel besucht die Figur Debbie, sie ist Schauspielerin und lernt für eine 80er-Jahre-Fernsehshow Wrestling, eine Männer-Wrestling-Veranstaltung. Sie sieht dort den Wrestler „Steel Horse“ kämpfen und kommt später mit ihm ins Gespräch. Er erklärt Debbie die erzählerische Beziehung seiner Kunstfigur zu ihrem Erzfeind „Mr. Monopoly“, gegen den er kurz zuvor im Ring stand. Es ist eine Geschichte von Gut gegen Böse, von Arbeit gegen Kapital.
Für GLOW ist das eine Schlüsselszene. Debbie lernt endlich die narrativen Strukturen des Wrestlings verstehen und erschafft sich ihre eigene Kunstfigur „Liberty Belle“, die innerhalb dieser Strukturen funktioniert. Ähnlich wie ihre Antagonistin Ruth, die zu ihrer Figur „Zoya the Destroya“ findet. Der humorvoll präsentierte Konflikt zwischen beiden Figuren steht für den Kalten Krieg, für den Gegensatz von USA und UdSSR.
Moralstücke im Wandel
Vor allem in der ersten Staffel ist GLOW nicht zuletzt eine Liebeserklärung an die Geschichtenwelt des Wrestlings, an seine Narrativität und Theaterhaftigkeit. Es geht um Dramaturgien und das Erfinden von Figuren, um ihre Hintergründe und Handlungsmotive. Es geht, wie im Wrestling selbst, um Storytelling.
„Wrestling-Matches sind Moralstücke im Kampfsport-Gewand“, schrieb kürzlich Mathis Raabe für die taz. Für frischen Wind sorgt hierbei allem Anschein nach die aufstrebende Wrestling-Liga All Elite Wrestling (AEW), die dem jahrzehntelangen Marktführer World Wrestling Entertainment (WWE) Konkurrenz macht, auch im Storytelling. Die AEW probiere dort Neues aus und thematisiere soziale Missstände.
So sei es ihrem amtierenden „World Champion“ Maxwell Jacob Friedman („MJF“) gelungen, eigene Erfahrungen mit Antisemitismus zum Thema zu machen und in die Geschichte seiner Figur zu integrieren. Die Wrestling-Welt, traditionell geprägt von problematischen Männlichkeitsbildern und, damit verbunden, erzählerischer Tristesse, sei im Umbruch, titelt die taz.
Novum in Europa
Ein anderes Zeichen dieses Umbruchs ließ sich am 11. November 2023 in Stuttgart-Untertürkheim beobachten. Dort fand in der gut besuchten Sängerhalle der erste „Walkyren-Cup“ statt, veranstaltet von Fury All-Women Pro-Wrestling Promotion. Ausschließlich Wrestlerinnen traten gegeneinander an, 14 an der Zahl, ein Novum in Europa.
„Sie haben Kampfnamen wie Heartbeat Girl, Queen Phoenixia oder Gaya Glass und stammen aus Kiel, Frankreich oder Israel.“
Unterstützt wurden sie dabei von zwei Schiedsrichterinnen und der Ringsprecherin Jennifer Hellmig, die die Veranstaltung als Co-Promoterin auch organisierte. Zusammen mit Marcel Durer, der die Idee zum Walkyren-Cup hatte und das Booking sowie die Planung der Matches verantwortete. Er hielt sich meist im Hintergrund auf, am Tisch mit der Ringglocke.
Der Superplex
Im Ring selbst also waren nur Frauen. Sie haben Kampfnamen wie Heartbeat Girl, Queen Phoenixia oder Gaya Glass und stammen aus Kiel, Frankreich oder Israel. Auch aus Großbritannien und Österreich waren Wrestlerinnen angereist. In sieben Matches gingen sie aufeinander los, darunter ein Tag-Team-Match (zwei gegen zwei), das außerhalb des Turnierverlaufs stattfand. Neben diesem Match, in dem Millie McKenzie, ein Star der Szene, auftrat, dürfte der Kampf zwischen Cory Zero und Jessy „F’N“ Jay ein Highlight des Abends gewesen sein.
Was beide im und außerhalb des Rings zeigten, war eine beeindruckend dynamische Kombination aus akrobatisch-halsbrecherischen Wrestling-Moves wie dem „Superplex“ und den Ringboden zum Scheppern bringender Kraft. Es hatte etwas von jenem US-amerikanischen Männer-Wrestling, das mich Anfang der 90er-Jahre als Kind vorm Fernseher begeisterte.

Begeistert schien von Anfang an auch das Publikum zu sein. Neben eingefleischten Wrestling-Fans sahen viele Zuschauer*innen, darunter ich, zum ersten Mal Live-Wrestling, wie eine Umfrage zu Beginn der Veranstaltung ergab. Der Stimmung schadete das nicht. Es dauerte nicht lange, bis Fans freudig im Chor „Auf die Fresse!“ forderten. Was anderswo als befremdliche Gewaltverherrlichung aufgefasst werden mag, wirkte hier eher sportlich als bedrohlich.
„Holy shit!“
Es hilft, zu wissen und sehen zu können, dass sich Wrestler*innen nicht wirklich „auf die Fresse“ schlagen, sondern nur so tun. Es ist eine Show, deren Ausgang in der Regel vorher feststeht, wie bei einem Theaterstück. Zudem gehören gelegentliches Pöbeln und Beleidigen zum Wrestling dazu, informiert das Programmheft. „Holy shit!“ war eine weitere Publikumsbekundung, die bei besonders beeindruckenden Aktionen zu hören war. Etwa, wenn sich die Wrestlerinnen außerhalb des Rings in unmittelbarer Nähe zum Publikum prügelten oder sich bis zur VIP-Empore durchschlugen.
„Wie sollen Frauen denn Bühnenerfahrung sammeln, wenn sie gar keine Chance bekommen?“ Marcel Durer, Wrestling-Promoter
Bei den Reaktionen des Publikums war für mich von besonderem Interesse, inwiefern es den Veranstaltenden gelang, ihre prominent im Programmheft und zuvor auf Instagram platzierte Absicht umzusetzen, bei rassistischen, sexistischen, homofeindlichen oder ähnlich diskriminierenden Äußerungen des Publikums sofort einzuschreiten. Glücklicherweise schienen solche Kommentare ausgeblieben zu sein.
Zwar wurde beim Kampf der Schwarzen Wrestlerin Queen Phoenixia mehrmals von der Empore „Welfare Queen“ gerufen, aber das mag ein, wohlwollend gedeutet, anerkennender Verweis auf die gleichnamige und prägnante Schwarze Figur in GLOW gewesen sein – und keine rassistische Beschimpfung, für die der Begriff ursprünglich steht (was auch in GLOW zur Sprache kommt).
Den Teufelskreis durchbrechen
Ebenfalls von besonderem Interesse für mich war die Frage, inwiefern der Walkyren-Cup als feministische Veranstaltung lesbar ist. Auch hierfür gab es im Vorfeld Anzeichen, neben der Positionierung gegen Sexismus und der für sich genommen schon feministisch deutbaren Tatsache, dass hier ein traditionell als sehr männlich geltender Sport, ein Kampfsport obendrein, ausschließlich von (nicht nur weißen) Frauen ausgeübt und von einer Frau mitorganisiert wird.
„Eine Frauen-Promotion ohne Frauen in Entscheidungsprozessen ist einfach nicht möglich“, heißt es im Instagram-Post, der Jennifer Hellmig vorstellt. Marcel Durer sagt dem Stuttgart-Magazin LIFT in der November-Ausgabe, dass es keinen Grund gebe, warum Frauen-Wrestling weniger Aufmerksamkeit erfahren sollte als Männer-Wrestling. „Wie sollen die Frauen denn Bühnenerfahrung sammeln, wenn sie gar keine Chance bekommen? Diesen Teufelskreis wollen wir durchbrechen.“

Durer sagt LIFT noch etwas, über das sich der Bogen zum Storytelling schlagen und zeigen lässt, dass der Walkyren-Cup, und wohl auch das Frauen-Wrestling insgesamt, das feministische Potential des Sports noch stärker nutzen könnte. „Wrestling ist ein bisschen wie Punkrock: Es ist schnell, es ist laut, es möchte was aussagen. Vor allem aber ist es interaktiv.“
Ja, der Walkyren-Cup war schnell, laut und interaktiv. Aber was wollte er aussagen? Dass Frauen auch professionell wrestlen können? Ja, können sie. Beeindruckend gut. Und das, ohne sich als Sexobjekte präsentieren und möglichst viel Haut zeigen zu müssen, wie es eine Zeit lang im US-Wrestling üblich war.
Motive und Konflikte
All das hat der Walkyren-Cup gezeigt, was angesichts der Benachteiligung des Frauen- gegenüber des Männer-Wrestlings eine sehr wichtige und fürs Erste vielleicht auch schon völlig ausreichende Leistung ist. Die Frage ist allerdings auch, gerade mit Blick auf zukünftige Veranstaltungen: Was ist mit dem Storytelling? Welche Geschichten werden erzählt? Warum stehen sich die Wrestlerinnen gegenüber, wofür kämpfen sie? Was sind ihre Motive und Konflikte? Welche Themen werden, mit den erzählerischen Möglichkeiten des Wrestling, verhandelt?
„Sie dürften im Ring vor allem Körper in Aktion sehen wollen und an Worten in Aktion weniger Interesse haben.“
Am Abend selbst ging das eher unter, vielleicht auch wegen der Akustik in der Halle. Ohne die Instagram-Beiträge zuvor und das ausführliche Programmheft hätte ich jedenfalls wenig über die Wrestlerinnen und ihre Hintergründe, oder vielmehr: die Hintergründe und Motive ihrer Kunstfiguren, erfahren.
Sicher, für viele Wrestling-Fans und Gelegenheitszuschauer*innen mag dieser erzählerische Aspekt des Wrestlings weniger wichtig sein, zumindest am Abend der Kämpfe. Sie dürften im Ring vor allem Körper in Aktion sehen wollen und an Worten in Aktion weniger Interesse haben.
Wrestling als Medium
Das ändert aber nichts daran, dass zum Wesenskern des Wrestlings auch Geschichten gehören. Hier unterscheidet sich Wrestling als geskriptete und stark fiktionalisierte Sportart wesentlich von anderen Sport- und gerade Kampfsportarten.
Geschichten können vor allem dann wichtig sein, wenn sich Kämpfer*innen wiederholt im Ring begegnen, über einen längeren Zeitraum. Hier wäre Raum für Handlungsbögen, die die Wrestler*innen in Konfliktbeziehungen zueinander setzen, ähnlich wie bei Liberty Belle und Zoya the Destroya in GLOW.
„Als eigene Kunstform kann aber auch Wrestling die Kerne solcher Themen berühren.“
Zeitgemäße Themen, die sich erzählerisch in Kämpfe einflechten ließen, wenn man das feministische Potential des Frauen-Wrestlings weiter entfalten möchte, könnten unter Umständen sein: Mutter- und Elternschaft, Care-Arbeit oder Ausbeutung am Arbeitsplatz.
Auf vliestext geht es um Kultur und Gesellschaft. Folgen kann man auf Instagram, Bluesky, Mastodon und per Newsletter:
Am Beispiel von Antisemitismus fragt Mathis Raabe in der taz: „Ist Wrestling ein geeignetes Medium, um derartige Geschichten zu erzählen?“ Wrestling ist sicherlich nicht das beste Medium, um solche Themen in Gänze zu verhandeln. Dafür sind seine erzählerischen Mittel im Vergleich eher begrenzt. Als eigene Kunstform kann aber auch Wrestling die Kerne solcher Themen berühren.
Und es kann etwas, das andere Medien in dieser, zumal körperlich intensiv vermittelten, Eindeutigkeit nicht unbedingt bieten können (oder wollen), viele Menschen als Botschaft aber brauchen: Am Ende gewinnt jemand. Oder verliert. ◆
Kaffeekasse
Sie haben hier etwas gelernt, sich informiert oder unterhalten gefühlt und wollen neuen Texten beim Wachsen helfen? Dann geben Sie uns doch einen Kaffee aus: