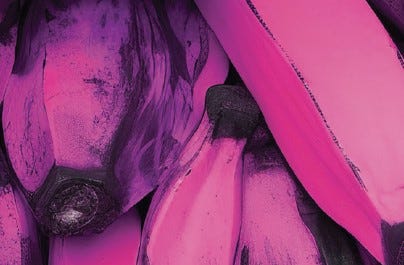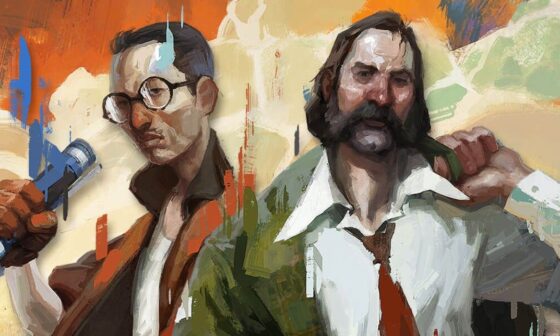Vor rund einem Jahrzehnt – oder vielleicht ist es noch länger her – habe ich es mir zur Gewohnheit gemacht, zu jedem Buch, das ich gelesen habe, eine kleine Besprechung zu schreiben. Sie dient mir vor allem als Erinnerungshilfe, aber auch als Mittel, mir bewusst zu machen, was ich gelesen habe.
Ich lese Bücher als Autorin und Privatperson, nicht als Feuilletonistin. Meine Kurzrezensionen, wie ich sie unbeholfen nenne, sind daher bloß ungeordnete Gedanken, die ich vor allem für meine Instagram-Follower aufschreibe. Hier auf vliestext finden sie nun auch ein Publikum.
Zuweilen fühlt sich dieser Akt des Nachdenkens und Schreibens wie eine Pflicht an, mit der ich einfach nur „durch“ sein möchte. Zum Glück aber nur zuweilen.
Alle Beiträge der Reihe „Durch!“ finden sich hier.
#10 Lea Ruckpaul: Bye Bye Lolita
Auf einen Klick: Es satt haben, Männerfantasie zu sein // Gelungene Charakterisierung // Bedingungsloses Gehaltenwerden // Das Patriarchat sprechen lassen
In Vladimir Nabokovs bekanntestem Werk Lolita verfasst der im Gefängnis sitzende (allzu unzuverlässige) Erzähler Humbert Humbert einen apologetischen Lebensbericht, in dem er seinen sexuellen Missbrauch an der zwölfjährigen Dolores Haze, die er Lolita nennt, schildert.
Der Roman gilt als Klassiker der Weltliteratur und polarisiert wie kaum ein anderer. Vor allem männliche Rezipienten betonen die künstlerische Komplexität des Werkes und sind angesichts des zur Schau gestellten Intellekts des Erzählers geneigt, den Missbrauch an Dolores als Ausdruck einer krankhaften Obsession zu bagatellisieren. Nicht-männliche Rezipient*innen dagegen fühlen sich sowohl von den intellektuell verbrämten, zuweilen kitschigen Tiraden Humberts als auch von der Behauptung desselben abgestoßen, das Kind habe ihn verführt.
Beide Arten, das Werk zu betrachten, zeugen nach meinem Dafürhalten von einer gewissen Blindheit. Die eine für die männliche Gewalt und die Traumata, die das zur Kindfrau fetischisierte Mädchen infolge des vielfachen sexuellen Missbrauchs erleidet. Die andere für das schriftstellerische Handwerk – weshalb auch die Unzuverlässigkeit des Erzählers bei der Bewertung des Romans häufig unter den Tisch fällt.
Es satt haben, Männerfantasie zu sein
Lea Ruckpaul gehört offenbar denjenigen Leser*innen an, denen Lolita eher Unbehagen bereitet als Begeisterung entlockt. Deshalb ist es in Ruckpauls Roman Bye Bye Lolita auch Dolores Haze selbst, die fast siebzig Jahre und zahlreiche gesellschaftliche Diskurse später Humberts autofiktionalen Bericht ihre eigene Sicht entgegensetzt.
In der erzählten Zeit des Romans blickt Dolores jedoch nicht als Achtzigjährige, so alt wäre sie jetzt, sondern als fast Vierzigjährige auf ihre traumatische Kindheit in den späten 1950er-Jahren zurück – ausgerüstet mit Gen-Z-Lingo sowie den Schlagworten und der Rhetorik feministischer Aktivist*innen unserer heutigen Zeit. Eins macht das Buch sofort klar: Diese Dolores Haze ermächtigt sich selbst, hat es satt, Opfer und ewig hebephile Männerfantasie zu sein. Bye Bye, Lolita, also.
„Dolores hat sich zwar de facto angenähert, nicht aber um Humbert zu verführen, wie dieser behauptet, sondern aus reiner Selbsterhaltung.“
In den ersten drei Teilen des Romans gibt Dolores die Ereignisse aus ihrer eigenen Perspektive wieder. Frappierend an dem Text ist, wie er das zuweilen irritierende Getändel des Mädchens, wie es in Humberts Aufzeichnungen beschrieben wird, weniger als verzerrte Darstellung desselben entlarvt – und somit als Resultat der Unzuverlässigkeit des Erzählers –, denn im Rahmen von Biografie und Psychodynamik plausibilisiert. So streitet Dolores eine Annäherung an Humbert nicht ab, sondern liefert vielmehr erstaunlich einleuchtende Erklärungen dafür.
„Ich war es, die ihn geküsst hat […]. Ich fragte mich, ob der Kuss genügen würde, um ihn davon zu überzeugen, mich nicht ins Erziehungsheim zu schicken, und wählte, nach einigem Grübeln, die offensive Strategie: ‚Was meinst du, würde Mama ziemlich toben, wenn sie herausbekäme, dass wir ein Liebespaar sind?‘“
Die von Ruckpaul kursivierten Originalzitate bekommen dadurch eine vollkommen neue Bedeutung: Dolores hat sich zwar de facto angenähert, nicht aber um Humbert zu verführen, wie dieser behauptet, sondern aus reiner Selbsterhaltung. Dass die Autorin sich für eine Plausibilisierung und gegen eine Bloßstellung männlicher Projektion entschieden hat, entpuppt sich sowohl als gewinnbringend als auch als unvorteilhaft.
Gewinnbringend, weil sie zeigt, wie unfreiwillig paradox sich Opfer zuweilen verhalten, um prekäre Lebensumstände überleben zu können, und dass Zustimmung in sexuelle Handlungen keineswegs mit realen Bedürfnissen korrespondieren muss. Unvorteilhaft, weil es aus dem von Nabokov als unzuverlässig angelegten Erzähler einen zuverlässigen macht – etwas, was nicht nur für die moralische, sondern auch literarische Bewertung von Lolita fatal ist.
Gelungene Charakterisierung
So problematisch diese erzählerische Entscheidung Ruckpauls auch erscheinen mag, ist die Konsequenz bemerkenswert, mit der sie aus der Projektionsfläche Lolita die junge Dolores herauslöst, die psychisch ums Überleben ringt und mithin gezwungen ist, zu allen erdenklichen Mitteln zu greifen.
Es ist der überaus gelungenen Charakterisierung Dolores‘ anzumerken, dass sich die Autorin mit dem Themenkomplex des sexuellen Missbrauchs, zumal in der Kindheit, intensiv auseinandergesetzt hat. Die Begründungen, die Dolores für ihr Handeln liefert, wirken zu keinem Zeitpunkt konstruiert, sondern so schlüssig, dass ich darüber kein einziges Mal ins Stolpern geriet.
In diesem Sinne verwundert es nicht, dass Dolores auch im vierten und letzten Teil des Romans, der dem Leben nach dem jahrelangen Missbrauch durch Humbert gewidmet ist, nichts an Glaubwürdigkeit einbüßt. Totgesagte leben länger, so auch Dolores. Sie ist nicht bei einer Geburt gestorben, wie es in einer Randnotiz in Nabokovs Vorlage heißt, sondern hat das Trauma überlebt, wenn auch sichtlich gezeichnet.
Bedingungsloses Gehaltenwerden
Aufgewachsen in einem Umfeld der Lieblosigkeit, Vernachlässigung und Gewalt hat Dolores weder gelernt, Grenzen zu ziehen, noch innige stabile Beziehungen zu anderen Menschen zu kultivieren. Eine der schönsten und zugleich schmerzhaftesten Sätze im gesamten Buch fasst das Dilemma der erwachsenen Dolores wie folgt zusammen:
„Für mich gibt es nur Einsamkeit oder bedingungsloses Gehaltenwerden. So wie ich gehalten werden müsste, kann mich niemand halten.“
Warum ich Ruckpauls Bye Bye Lolita trotz seiner offensichtlichen Stärken für einen sehr guten, nicht aber brillanten Text halte, liegt zum einen am zuweilen teenagerhaften Duktus von Dolores, der in meinen Augen weder zu einer gereiften Vierzigjährigen passen will, noch zu der Zeit, wo das Buch innerhalb des zeitlichen Kosmos der Vorlage angesiedelt sein müsste – in den 1970er-Jahren.
Zum anderen daran, dass immer dann, wenn Ruckpaul induktiv aus der Gewalt und dem Gebaren Humbert Humberts sowie der Willfährigkeit weiblicher Vorbilder wie der Mutter oder der Lehrerin allgemeine Diagnosen über unsere heutige Gesellschaft ableitet, erzählerische Eleganz vermissen lässt.
Das Patriarchat sprechen lassen
So verfällt Dolores immer wieder in einen Aktivist*innensprech, benutzt Schlagworte wie „patriarchalisch“ und spricht konkret über männliches Anspruchsdenken usw. Inhaltlich mag das ja alles korrekt sein, geht aber weder über das Level feministischer Allgemeinplätze hinaus, noch überzeugt es ästhetisch. Das Patriarchat darzustellen und für sich sprechen zu lassen, anstatt mit dem Finger darauf zu deuten und zu sagen, das ist das Patriarchat, wäre für mich die künstlerisch bessere Variante gewesen.
Dennoch: Lea Ruckpauls Debüt hat mir zu meiner Überraschung sehr gut gefallen und viele Befürchtungen, die ich im Vorfeld der Lektüre hatte, wenn auch nicht vollumfänglich, so doch weitgehend widerlegt. Sinnvoll wäre es natürlich, Nabokovs Lolita schon einmal gelesen zu haben, um einen Eindruck davon zu bekommen, wogegen die Figur Dolores Haze in Bye Bye Lolita anschreibt. ◆
Lea Ruckpaul: Bye Bye Lolita, Verlag Voland & Quist, Berlin, 2024.
Auf vliestext geht es um Kultur und Gesellschaft. Folgen kann man auf Instagram, Bluesky, Mastodon und per Newsletter:
Autorin
Unterstützen
Texte wachsen nicht nur aus Liebe. Es braucht auch Geld. Wer vliestext welches geben will, wirft was in die Kaffeekasse. Die kann PayPal und Ko-fi.